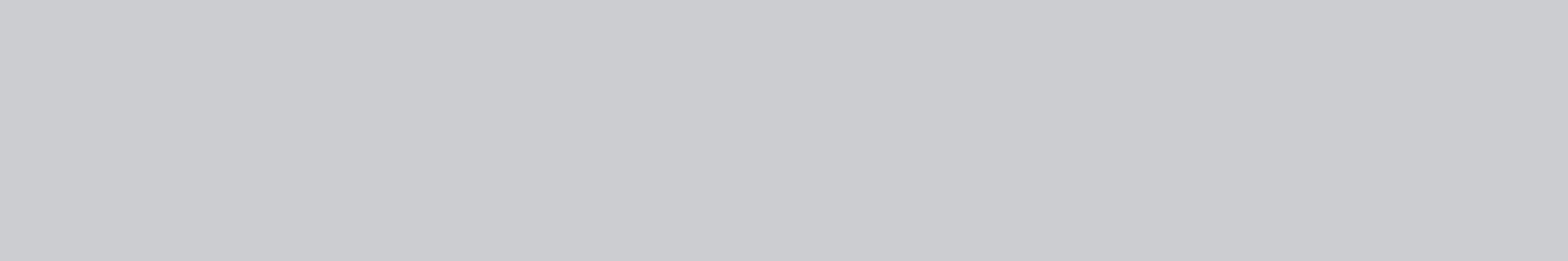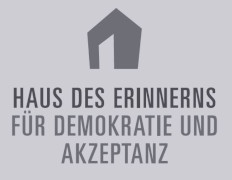Als die Bundesrepublik vor einem Dreivierteljahrhundert ins Leben trat, verdankte sich das der Entschlusskraft der westlichen Alliierten, aber auch der Bereitschaft einer neuen deutschen politischen Elite, die Konsequenzen aus dem Scheitern der Weimarer Republik und der Katastrophe des „Dritten Reiches“ zu ziehen. Zu diesen Konsequenzen gehörte nicht zuletzt die Bereitschaft, sich der „jüngsten Vergangenheit“ selbstkritisch zu stellen.
Auf den ersten Blick waren die Bedingungen für einen staatlichen Neuanfang in nahezu jeder Hinsicht entmutigend – politisch, ökonomisch, moralisch. Besonders eklatant war in den Augen der Alliierten und der Gegner des NS-Regimes der charakterliche Bankrott der eben noch so herrisch-stolzen „Volksgemeinschaft“. Sie warf Fragen auf wie die folgenden: Wie lässt sich der Übergang von einer totalen Diktatur zur freiheitlichen Demokratie in einem physisch und psychisch völlig verwüsteten Land organisieren? Wie verändert man das Denken und Handeln einer Nation, die ihrem „Führer“ im Vernichtungskrieg mit übergroßer Mehrheit, wenn nicht begeistert, so doch loyal bis ans Ende gefolgt war? Wie gewinnt man die zutiefst erschöpften und vielfach zynisch gewordenen Deutschen für eine neue, humane politisch-gesellschaftliche Ordnung?
In seinem neuen Buch geht der renommierte Zeithistoriker Norbert Frei und Seniorprofessor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Jena anknüpfend an seine Standardwerke „Vergangenheitspolitik“ oder „1945 und wir“ Fragen wie den folgenden nach: In welcher Weise machten die Bundespräsidenten der Bonner Republik – Theodor Heuss, Heinrich Lübke, Gustav Heinemann, Walter Scheel, Karl Carstens und Richard von Weizsäcker – die Verbrechensgeschichte des „Dritten Reiches“ zu ihrem Thema? Wo setzten sie Schwerpunkte, was waren ihre blinden Flecken …? Beförderten sie den öffentlichen Diskurs über die Vergangenheit oder begünstigten sie deren Beschweigen? Diese „Geschichte von Schuld und Scham, von Vergessen und Vergegenwärtigung“ erzählt der Autor auf breitester Quellengrundlage nicht nur der Akten des Bundespräsidialamtes, von persönlichen Nachlässen, Personalakten, der in Staats- und Landesarchiven ermittelten Entnazifizierungsakten sowie der zeitgenössischen Presse und des Rundfunks in seinem glänzend geschriebenen Buch, Dabei wird die ganze Bandbreite von z. T. auch ambivalenten Verhaltensweisen der ersten sechs Bundespräsidenten deutlich, die die NS-Zeit noch selbst erlebt hatten und in unterschiedlicher Weise in sie „verstrickt“ waren. Dennoch ist deren Amtszeit und die normative Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit von überraschender Kontinuität. So ist hinter Heuss‘ Schlussstrich unter die Vergangenheitsbeschweigung und -verdrängung mit seinem Eingeständnis „Wir haben von diesen Dingen gewusst.“ keiner seiner Nachfolger zurückgegangen. Überraschend erscheint in diesem Zusammenhang wie unterschiedlich die öffentliche Wahrnehmung und Beurteilung ihrer Lebens- und Karrierewege während der NS-Zeit war. Obwohl z. B. Lübke und Heinemann zu den Funktionseliten des Staates gehörten oder bei Scheel und Carstens deren vormalige Mitgliedschaft in der NSDAP nahezu gleichzeitig bekannt war, wurde sie auffällig unterschiedlich bewertet. Die genauere Betrachtung zeigt auch, dass Richard von Weizsäckers berühmte Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985 einerseits in der öffentlichen Wahrnehmung eine entscheidende Zäsur bedeutete, indem sie die Kapitulation und Niederlage der Wehrmacht zugleich als „Tag der Befreiung“ (gegen enorme Kritik in seiner eigenen Partei und bei vielen Zeitgenossen) deklarierte. Andererseits war diese veränderte Beurteilung schon in Statements seines Vorgängers und auch des Bundeskanzlers angeklungen, sie war aber nicht in die öffentliche Wahrnehmung transportiert worden. Gerade in dieser Hinsicht bietet das neue Buch von Norbert Frei vertiefende und z. T. überraschende Einblicke in die Nachkriegsgeschichte der ersten 40 Jahre, die nach einem differenzierenden Urteil der Biografien von Zeitgenossen verlangen, die vom Leben unter der NS-Diktatur geprägt waren und nach 1945 erst den Weg zu einem demokratischen Staat finden mussten.

Gemeinsam mit der Volkshochschule Mainz und der Landeshauptstadt Mainz hatten wir Norbert Frei aus Anlass des 75jährigen Jubiläums des Grundgesetzes zu einem Festvortrag nach Mainz eingeladen, bei dem der Fokus auf der Rolle der ersten sechs Bundespräsidenten (1949–1994) im Blick auf die NS-Vergangenheit und die demokratische Neuorientierung nach 1945 lag.
Norbert Frei: Im Namen der Deutschen. Die Bundespräsidenten und die NS-Vergangenheit. 377 S., geb. 28,00 €, C.H.Beck-Verlag München 2023 (ISBN: 978-3-40680-848-7)