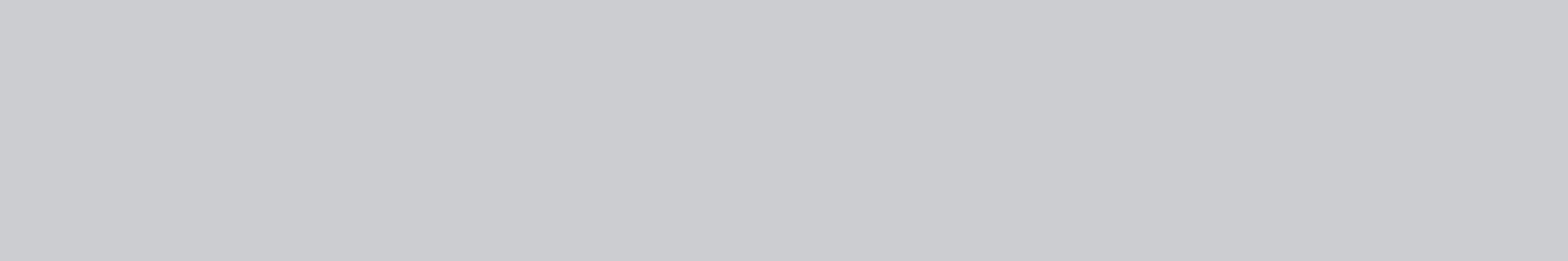Seit über vier Jahren engagiert sich Emilia Taran ehrenamtlich im Begegnungsprojekt „Meet a Jew”, das aus dem Zusammenschluss der beiden Projekte „Likrat – Jugend & Dialog” und „Rent a Jew“ erfolgt ist. Durch persönliche Begegnungen möchte sie über jüdisches Leben informieren, mit anderen ins Gespräch kommen und so auch Vorurteilen und Stereotypen vorbeugen. Wir sprachen mit ihr über ihr langjähriges Engagement, den Stellenwert von Begegnungsprojekten und darüber, was es für sie persönlich bedeutet, „jüdisch” zu sein.
Interview: Janika Schiffel | Juli 2021

Zur Person
Emilia Taran ist 21 Jahre alt und studiert Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Migration und Integration in Mainz. Sie ist im Herzen Israels, in einer Stadt zehn Minuten von Tel Aviv entfernt, geboren. Dort lebte sie zwei Jahre, bevor sie mit ihren Eltern nach Trier zog. Emilia Taran ist selbst „mit dem jüdischen Leben aufgewachsen”: Angefangen mit dem regelmäßigen Besuch in der jüdischen Gemeinde mit einem Jugendzentrum, Religionsunterricht und Gottesdiensten bis hin zum Engagement in vielen jüdischen Einrichtungen und Projekten. So ist sie beispielsweise auch bereits seit vielen Jahren im Projekt „Meet a Jew” aktiv.
Foto: privat
Sie selbst engagieren sich ehrenamtlich bei „Meet a Jew“, einem Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden, das 2020 aus den Projekten „Rent a Jew“ und „Likrat” hervorgegangen ist. Welche Idee steht hinter „Meet a Jew“?
„Miteinander statt übereinander” ist das Motto von „Meet a Jew”. Denn im direkten Austausch ist es viel leichter, gegenseitiges Verständnis zu erlangen und individuelle Perspektiven und Ansichten auszutauschen. Leider ist es in Deutschland mit nur 0,12 Prozent Anteil von Jüdinnen und Juden rein rechnerisch schwierig, mit Menschen jüdischen Glaubens im Alltag bewusst in Kontakt zu treten. Umso wichtiger ist es, Begegnungen zu organisieren, um sich auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist es auch, was „Meet a Jew” erreichen möchte. Damit möchten wir das aktuelle jüdische Leben in Deutschland und unseren persönlichen Alltag zeigen. Mit unserer Vielfalt, dem Bezug zur Gegenwart und den individuellen Einblicken im Gegensatz zu Geschichtsbüchern und Wikipedia-Artikeln. Die Freiwilligen von „Meet a Jew” sind da, um über ihr persönliches Judentum zu sprechen. Egal, ob man religiös ist oder nicht, orthodox oder liberal. Nur so gelingt es, das oft abstrakte Bild von ‚den Juden‘ in unserer Gesellschaft aufzubrechen und eine Vielzahl von authentischen jüdischen Gesichtern und Perspektiven kennenzulernen.
Seit vier Jahren engagieren Sie sich schon bei „Meet a Jew”. Wie sind Sie dazu gekommen und welche Bedeutung hat Ihr Engagement für Sie?
Ich bin auf das Projekt im Jahre 2017 auf dem größten jüdischen Tanz- und Singwettbewerb Europas namens „Jewrovision” aufmerksam geworden. In unserem Hotel war ein Stand, wo man sich informieren konnte. Ich habe nicht lange gezögert und mich sofort vor Ort angemeldet. Ein derartiger Dialog hat mich sehr fasziniert. Denn es ist für mich wichtiger denn je, der Gesellschaft in Deutschland das aktuelle jüdische Leben von Angesicht zu Angesicht näherzubringen. Ein Großteil kennt Jüdinnen und Juden wirklich bewusst nur aus Geschichtsbüchern oder in Verbindung mit dem Nationalsozialismus. Das ist zwar auch ein Teil der jüdischen Identität, der nicht vergessen werden sollte, doch der restliche Teil ist nur Wenigen bekannt und nicht selten durch Vorurteile geprägt. Gemeinsam mit „Meet a Jew” ist es mir wichtig, vorhandene Vorurteile abzubauen und, noch besser, sie erst nicht aufkommen zu lassen. Das funktioniert nur, wenn man miteinander statt übereinander spricht – so ja auch das Motto von „Meet a Jew”. Durch einen Austausch schaffen wir es, uns besser in die Lage des jeweils anderen hineinzuversetzen und gegenseitiges Verständnis zu entwickeln.

Wie sieht eine Begegnung über „Meet a Jew“ typischerweise aus? Gibt es Begegnungen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Sowohl online als auch in Präsenz habe ich bereits an vielen Begegnungen teilgenommen. Eine Begegnung wird immer von zwei Freiwilligen durchgeführt. Diese Begegnungen können in einem Verein, einer Schulklasse, einer Universität oder in anderen Institutionen und unterschiedlichen Altersgruppen stattfinden. Vorzugsweise setzen wir uns in einen Stuhlkreis, um ein dynamisches Gespräch auf Augenhöhe führen zu können. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen wir mit dem Austausch. Sei es mit Fragen, jüdischen Speisen oder gar Spielen. Ich erzähle zum Beispiel auch, warum ich persönlich keine Salami auf der Pizza oder keinen Cheeseburger esse und was es mit den jüdischen Speisegesetzen auf sich hat. Außerdem bringe ich gerne traditionelle Gegenstände oder Geschichten zu bevorstehen Feiertagen mit. Damit können wir die jüdischen Traditionen den Gruppen sehr gut näherbringen. Aber auch allgemeine Fragen zu unserem Alltag können gerne gestellt werden. Besonders jüngere Gruppen interessieren sich für Hobbies oder Lieblingsessen.
Jede Begegnung ist für mich einzigartig und in jeder lerne ich auf verschiedene Art und Weise etwas dazu. Dementsprechend habe ich alle Begegnungen schön in Erinnerung. Am meisten freut es mich, wenn ich spüre, dass wir ein positives Bild hinterlassen haben und die Gruppe Spaß an der Begegnung hat.
Gibt es etwas, von dem Sie während den Begegnungen besonders gerne berichten?
Ich berichte gerne über meine persönlichen Erfahrungen und Ansichten. Das kann schon bei der Frage „Was ist dein Lieblingsfeiertag im Judentum?” beginnen. Ich freue mich immer, einen Einblick in meinen Alltag geben zu können, weg vom Allgemeinen und näher ans Persönliche. Grundsätzlich freue ich mich jedoch über alle Fragen.
Eine persönliche Begegnung über „Meet a Jew“ soll auch Vorurteilen und Stereotypen entgegenwirken. Sind Sie selbst in Ihrem Alltag mit Vorurteilen und Antisemitismus konfrontiert? Und Inwiefern thematisieren Sie dies während der Begegnungen?
Häufig werde ich mit der Aussage konfrontiert „Du siehst ja gar nicht aus, wie eine Jüdin”, woraufhin ich mit der Gegenfrage „Wie sieht denn für dich ein Jude aus?” komme. Die meisten wissen nicht, was sie darauf antworten sollen. Der Großteil kennt Jüdinnen und Juden aus Filmen, Geschichtsbüchern oder von Erzählungen. Sie sehen dann häufig religiöse Männer mit Schläfenlocken, Hüten und langen schwarzen Mänteln. Jüdinnen und Juden, die nicht so dargestellt werden, werden häufig nicht erkannt. Doch das Judentum ist vielfältig und so auch das Aussehen jedes einzelnen Menschen.
Auch das Wort ‚Jude‘ wird oft traurigerweise als Schimpfwort benutzt. Viele trauen sich deswegen nicht, das Wort in meiner Gegenwart auszusprechen.
Antisemitismus ist ein Thema, das mich leider viel beschäftigt und ich auch von vielen Seiten erlebe. Als in Israel geborene Jüdin werde ich vor allem mit israelbezogenem Antisemitismus besonders auf Social Media konfrontiert. Doch auch Jüdinnen und Juden, die nicht in Israel geboren sind, bekommen vor allem in letzter Zeit viel davon ab. Das erzähle ich auch oft in Begegnungen. Antisemitismus ist kein Tabuthema, das umgangen werden darf. Es muss offen ausgesprochen und beim Namen genannt werden, um Menschen auf das Problem in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass Antisemitismus aus allen Richtungen kommen und deswegen nur gemeinsam bekämpft werden kann.
Initiativen und Projekte wie „Meet a Jew“ geben jüdischem Leben und jüdischer Kultur ein Gesicht in der Öffentlichkeit. Dennoch ist die öffentliche Wahrnehmung, wie Sie sagen, von jüdischen Menschen und dem Judentum scheinbar oft vom Nationalsozialismus geprägt. Konnten Sie Ähnliches auch während der Begegnungen über „Meet a Jew“ beobachten?
Ich teile diese Erfahrung absolut und habe selbst schon einige Male dieses „Experiment” mit einigen Gruppen durchgeführt. Die meisten Teilnehmer_innen assoziieren mit dem Judentum negative Aspekte aus dem Nationalsozialismus. Es wundert mich allerdings nicht, da es ein Teil unserer Sozialisierung ist. Denn wenn beispielsweise in der Schule etwas über das Judentum gelehrt wird, dann fokussiert man sich hauptsächlich auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Der Nationalsozialismus ist ein wichtiges Thema, welches dringend weiter aufgearbeitet werden muss und auch stärker in der Schule gelehrt werden sollte. Gleichzeitig sollten aber auch die verschiedensten Religionen und Kulturen sowie ihre Traditionen, die unsere Gesellschaft heute prägen, um einiges mehr behandelt werden. Dann bin ich mir sicher, dass nicht nur die negativen Assoziationen im Vordergrund stehen. „Meet a Jew” ist daher ein wichtiges Projekt, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

2021 wurde zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ausgerufen. Wie denken Sie darüber?
1700 Jahre zeigt uns, dass Jüdinnen und Juden schon eigentlich immer ein Teil unserer Gesellschaft waren. Gerne nehme ich, sei es in der Jüdischen Gemeinde oder privat, an Veranstaltungen dazu teil und freue mich, in diesem Rahmen eingeladen zu werden. Außerdem ist das Judentum mit Deutschland durch eine starke Geschichte verbunden. Denn Deutschland war schon im Mittelalter ein wichtiges Zentrum des jüdischen Lebens mit berühmten jüdischen Schulen, Städten, Rabbinern und Gelehrten, die bis heute das Judentum prägen. Auch die Entstehung des konservativen Judentums fand in Deutschland statt. Daher scheint es, als hätte das jüdische Leben in Deutschland ständig geblüht.
Blicke ich jedoch mit einer anderen Perspektive in die Vergangenheit und auch in die Gegenwart, sehe ich über „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland” eine traurige Vergangenheit, die uns bewusst sein muss. Denn auch hier aus Deutschland mussten Jüdinnen und Juden sowohl im Mittelalter als auch im dunkelsten Kapitel der Geschichte, dem Nationalsozialismus, permanent fliehen. Ausgrenzungen und schlechte Behandlung gehörten leider zum Alltag. Das Judentum war also schon immer hier, jedoch nie von der Gesellschaft vollständig akzeptiert. Mit dem deutlich steigenden Antisemitismus von allen Seiten (von Rechts, Links, in Teilen der muslimischen Bevölkerung, aber auch in der gesellschaftlichen Mitte usw.) zeigt sich, dass wir das Thema in Deutschland stark aufarbeiten müssen. Daher hoffe ich sehr, dass wir während des „Festjahres” nicht nur feiern, sondern uns auch erinnern, gedenken und niemals vergessen. Und das nicht nur im Rahmen von „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland”, sondern auch danach.
Was bedeutet „Jüdisch sein“ für Sie?
Das Judentum bedeutet für mich eine unfassbar starke Gemeinschaft, die immer für einen da ist. Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart waren wir immer ein Volk, das zusammengehalten hat, auch wenn wir auf der ganzen Welt verteilt sind. Das sieht man auch in den jüdischen Gemeinden. Einfach eine große Familie. Wir sind eine Das Judentum bedeutet für mich eine unfassbar starke Gemeinschaft, die immer für einen da ist. Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart waren wir immer ein Volk, das zusammengehalten hat, auch wenn wir auf der ganzen Welt verteilt waren. Das sieht man auch in den jüdischen Gemeinden. Einfach eine große Familie. Wir sind eine ethnische Gruppe, die ihre Traditionen und Werte von Generation zu Generation weitergibt, egal was komme. Das „Jüdisch sein” heißt also für mich auch Verantwortung, ein Schatz, den ich nicht verlieren darf. Ich sage mir immer: „Wenn meine Vorfahren es in den schwersten Zeiten geschafft haben, das Judentum weiterzugeben, dann schaffe ich das auch”. Und das mit viel Freude und Leidenschaft, die wir in unseren jüdischen Gemeinden und in unserem Alltag zeigen. Daher schätze ich das am „Jüdisch sein” sehr.

Wann haben Sie begonnen, sich mit Ihrer jüdischen Identität auseinanderzusetzen und wie leben Sie diese heute?
Meine Eltern sind mit mir schon von klein auf regelmäßig in die Gemeinde gegangen. Damals sah ich es als völlig normal an, am jüdischen Leben teilzuhaben und habe es auch nicht wahrgenommen, dass ich eine „andere” Kultur als die anderen hatte. Erst als ich älter wurde, habe ich erfahren, dass ich zu einer „Minderheit” in Deutschland gehöre. Anfangs habe ich durch Erzählungen meiner Eltern und den regelmäßigen Besuchen in Gottesdiensten und im Jugendzentrum über meine Vorfahren, unsere Geschichte und unsere Traditionen und Werte erfahren. Das alles weckte mein Interesse an meiner jüdischen Identität immer weiter und ich habe begonnen, mich selbstständig damit zu beschäftigen. So bin ich auch immer bewusster gläubig geworden und habe immer mehr Traditionen, wie zum Beispiel die Speisegesetze („Kashrut”), eingehalten. Heute bezeichne ich mich selbst als traditionell und gläubig. Ich versuchte, so viele Werte wie möglich zu leben.
Sie selbst leben seit einiger Zeit in Mainz – davor waren Sie lange in der Trierer Gemeinde aktiv. Wie unterscheidet sich das jüdische Leben in den beiden Städten?
Nach Mainz bin ich mitten in der Corona-Zeit gezogen. Da hat es sich bis jetzt leider noch nicht wirklich ergeben, aktiv am jüdischen Leben teilzunehmen. Rein faktisch kann ich sagen, dass beide orthodoxen Gemeinden mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden das Judentum in Deutschland in der Geschichte stark prägten. Mainz ist besonders und gehört zu den sogenannten SchUM-Städten, die jetzt zum Weltkulturerbe ernannt wurden. Auch in Trier gab es ein starkes jüdisches Leben. Persönlich sehe ich die Trierer Gemeinde als meine Familie an. Gemeinsam mit weiteren tollen Menschen, egal ob jung oder alt, bin ich in der Gemeinde aufgewachsen und verbringe immer noch gerne Zeit mit ihnen. Dementsprechend hat die Trierer Gemeinde einen festen Platz in meinem Herzen, den keiner ersetzen kann. Ich bin allerdings der Meinung, dass in jeder jüdischen Gemeinde das jüdische Leben etwas Besonderes ist und man es daher nicht vergleichen kann. Letztendlich teilen wir alle dieselben Werte, die uns miteinander verbinden, unabhängig davon, von wo wir kommen.
Dabei ist es wichtig, aktiv zu sein. In Mainz habe ich begonnen, das Jugendzentrum als Betreuerin zu besuchen, was mir wahnsinnig Spaß macht und ich hoffe, dass ich mich möglichst bald auch hier noch mehr beteiligen kann.
Was würden Sie sich für ein aktives, sichtbares jüdisches Leben in Mainz wünschen?
Da ich im Studierendenalter bin, würde ich mich freuen, wenn wir mit Studierenden in einen guten Kontakt treten könnten. Mein Wunsch für ganz Rheinland-Pfalz wäre es, ein starkes Netzwerk unter jüdischen Studierenden aufzubauen. So könnten wir unsere Interessen repräsentieren, eine jüdische Stimme entwickeln und das jüdische Leben in Mainz und Rheinland-Pfalz sichtbarer machen. Ich bin mir sicher, dass wir das Potenzial dazu haben.
Meet a Jew
„Meet a Jew” ist ein Projekt des Zentralrats der Juden, das Unwissen, Vorbehalten und Vorurteilen durch persönliche Begegnungen entgegenwirkt: „Das aktuelle jüdische Leben durch in Deutschland lebende jüdische Menschen kennen lernen, das ist die Idee hinter Meet a Jew. Denn eine persönliche Begegnung bewirkt, was tausend Bücher nicht leisten können. Wer Jüdinnen und Juden schon mal persönlich getroffen hat, ist weniger anfällig für Stereotype und Vorurteile und weiß, dass es viel mehr Themen gibt über die wir miteinander sprechen können als über Antisemitismus, die Shoah oder den Nahostkonflikt.”
Auf der offiziellen Homepage des Projekts „Meet a Jew” finden Sie weitere Informationen. Hierüber können auch persönliche Begegnungen vereinbart werden.