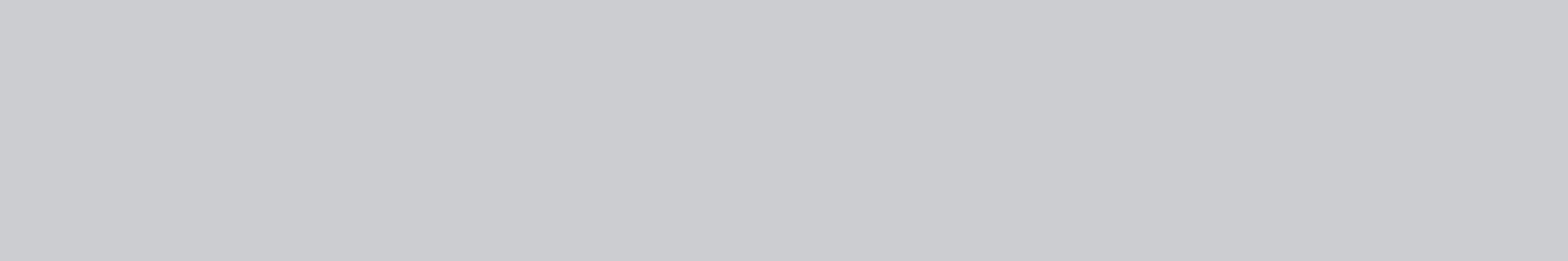Knapp 30 Jahre lang arbeitete Regine Gabriel als Pädagogin in der Gedenkstätte Hadamar. Wir sprechen mit ihr über Gedenkstättenpädagogik mit Kindern und der Arbeit an einem historischen Ort, der Tötungsanstalt der sogenannten Aktion T4 war und in dem die Nationalsozialisten etwa 15.000 Menschen ermordeten.
Interview: Dr. Cornelia Dold & Janika Schiffel | April 2020

Zur Person
Regine Gabriel war von 1989 bis 2019 als Pädagogin an der Gedenkstätte Hadamar tätig und dort mit dem Aufbau und der Entwicklung der pädagogischen Arbeit betraut. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit lag dabei insbesondere auf der Jugend- und Kinderbildung. Sie ist darüber hinaus Theaterpädagogin BuT und schloss ihr Studium mit dem ersten und zweiten Staatsexamen für die Fächer Deutsch und Politik für das Lehramt an Gymnasien ab.
Wie war es für Sie persönlich, an einem solchen Ort zu arbeiten?
„Ich hatte das Glück, in einem politischen Elternhaus groß zu werden, im Frankfurter Westend, in dem ab Mitte der 1960er Jahre politisch immer etwas los war. Das hat sich auch auf meinen Politikunterricht ausgewirkt. Was heißt, bei mir in der Schule kam das Thema Nationalsozialismus vor! Elternhaus und Schule waren sicher so prägend, dass ich mich immer mehr für den Themenbereich NS und Judenverfolgung interessierte.
Dass ich letztendlich an der NS-‚Euthanasie‘-Gedenkstätte in Hadamar gelandet bin, war reiner Zufall und einem Wohnortwechsel geschuldet. Anfangs fand ich den Keller mit der ehemaligen Gaskammer, dem Sezierraum und dem Standort der Krematorien äußerst belastend. Ich habe mir den Eigenschutz genommen, Gruppen nicht immer in diesen Keller mit zu begleiten. Das war zu einer Zeit, in der ich alleine Gruppenbegleitungen gemacht habe.
Später war ich in der gesamten Gedenkstätte zu Hause. Das heißt, je mehr ich mich mit den Menschen, die in Hadamar ermordet worden waren, beschäftigte, je mehr ich über die Familien erfahren habe, desto vertrauter wurden mir die Geschichten und damit auch die Räume. Dazu gehört auch der Friedhof auf dem Gelände, auf dem während der dezentralen ‚Euthanasie‘ 1942–1945 circa 4.500 Menschen in Massengräbern verscharrt wurden. Dieser Friedhof war für mich immer Gedenkort und Rückzugsort.
Ich bin der Überzeugung, um in einer NS-Gedenkstätte zu arbeiten, bedarf es viel Humor, meistens gute Laune und Kolleg*innen mit denen man über Gott und die Welt reden und auch schon mal streiten kann.“

Was erwartet Schüler*innen an diesem historischen Gedenkort? Wie sehen idealerweise Vor- und Nachbereitung eines Besuches der Gedenkstätte aus?
„Zunächst kommen Schüler*innen in ein Krankenhaus. Die Seminarräume der Gedenkstätte befinden sich in einem Krankenhausbau von 1883. Das Hochparterre mit hellen Räumen, lässt keine ‚unguten‘ Gefühle aufkommen. Üblicherweise werden die Schüler*innen zu einem Einführungsvortrag in das Thema NS-‚Euthanasie‘-Verbrechen in Hadamar im Seminarraum erwartet. Danach beginnt der Rundgang über das Gelände mit dem Besuch der historischen Orte wie Busgarage, Keller, Friedhof. Bei diesem Rundgang lernen die Schüler*innen mithilfe von Biografiekarten eine Auswahl der ermordeten Menschen kennen. Sie sollen sich die Geschichte durch Geschichten und Bilder aneignen. Immer wieder gibt es in den drei Stunden, die eine Regelbegleitung dauert, Gesprächsmöglichkeiten.
Zur Vorbereitung in der Schule gehört unbedingt die Einordung des NS-Krankenmordes in den Kontext der NS-Verbrechen und des Vernichtungssystems. Der Krankenmord ist eine Besonderheit, deren Abgrenzung zur Ausgrenzung bis hin zur Ermordung der Jüdinnen*Juden, deutlich gemacht werden muss.
Für die Nachbereitung sollte es unbedingt Raum geben, in dem die Schüler*innen auch über ihre Emotionen sprechen können, was der geschützte Raum Schule häufig erleichtert.
Besonders eindrücklich sind Nachbereitungen, die in kleineren Projekten wie zum Beispiel einer Ausstellung gipfeln.“
Gibt es ein Projekt oder eine Besuchergruppe, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
„Nach 30 Berufsjahren in der Gedenkstätte Hadamar ist das eine schwierige Frage. Es gab immer wieder Gruppen, Einzelpersonen, Projekte, die etwas ‚Besonderes‘ waren. Vielleicht waren die Theaterprojekte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die, die für mich einerseits außerordentlich anstrengend waren, aber gleichzeitig auch am erfolgreichsten gezeigt haben, wie nachhaltige Gedenkstättenarbeit auch gehen kann. Zu beobachten, wie die Teilnehmer*innen dieser Projekte mit Mitteln der Theaterarbeit aus sich selbst herauswachsen, selbstbewusster und sicherer im Auftreten werden, plötzlich eine laute Stimme erheben können, das ist einfach großartiges Lernen. Für diese Erfahrungen bin ich unendlich dankbar. Denn ohne dass sich Teilnehmer*innen auf solche Lernprozesse einlassen, gibt es eben auch solche Projekte nicht.“
Welche Besonderheiten lassen sich bei der gedenkstättenpädagogischen Arbeit mit Kindern feststellen?
„Das für mich Auffälligste ist die Tatsache, dass Kinder an diesem Ort mit seinen Geschichten nicht zu überfordern sind. Kinder nehmen nur so viele Informationen auf, wie sie verarbeiten können. Wird es ihnen zu viel, entziehen sie sich, indem sie unaufmerksam werden oder gar den Seminarraum verlassen. Dann ist Pause angesagt. Danach kann es weitergehen.
Zentral ist meiner Meinung nach auch, dass ein Gedenkstättenbesuch eine kreative Herausforderung für die Gedenkstättenmitarbeiter*innen ist. Und dass es Mut zur historischen Lücke geben darf und muss.“
Wie nehmen Kinder den Ort wahr und welche Fragen ergeben sich häufig?
„Die historischen Kellerräume nehmen die Kinder in aller Regel als extrem klein und eng wahr. Sie können fast nicht glauben, dass es nur eine Gaskammer gab. Alle anderen Räume, wie Seminar- und Ausstellungsraum oder Busgarage und Innenhof, erobern sich die Kinder sehr schnell. Sie verlieren dann auch die Scheu, sich frei und laut in der Gedenkstätte zu bewegen.
Die häufigste Frage ist die, wie es sein kann, dass Menschen anderen Menschen so viel Leid zufügen können.“
Wie schätzen Sie die Rolle der Eltern bei Gedenkstättenbesuchen von Kindern ein?
„Die Rolle der Eltern ist eine ganz zentrale. Denn wenn Eltern sich strikt gegen einen Besuch ihrer Kinder in der Gedenkstätte aussprechen, muss das respektiert werden. Daher ist die Arbeit mit den Eltern genauso wichtig, wie die mit den Kindern. Es hilft, wenn die Eltern im Vorfeld die Gedenkstätte kennenlernen konnten. Idealerweise im Kontext mit einem Elternabend, der dann in der Gedenkstätte stattfindet. Es ist immer wichtig, die Ängste der Eltern wahr- und ernst zu nehmen, denn um diese geht es. Dass die Kinder vor den schrecklichen Ereignissen geschützt werden müssen, ist ein vorgeschobenes Argument, um sich nicht mit den eigenen erwachsenen Ängsten zu beschäftigen.“

Häufig wird infrage gestellt, ob Gedenkstättenpädagogik für Kinder geeignet ist. Wo liegt aus Ihrer Sicht der Gewinn von Bildungsarbeit mit Kindern an einem historischen Lernort?
„Ich glaube diese Frage kann man so nicht stellen. Es geht ja nicht um Gedenkstättenpädagogik und deren Eignung für Kinder. Es geht darum, ob Kindern ein Besuch einer NS-Gedenkstätte zugemutet werden kann/darf.
Dazu kann ich sagen, dass selbstverständlich nicht jedes Kind einer 4. Klasse unbedingt eine NS-Gedenkstätte besuchen muss. Doch wenn es einen solchen Lernort in der Nähe gibt und es thematisch sinnvoll ist, gibt es keinen Grund ihn nicht zu besuchen mit den Kindern. Historische Orte sind per se für Kinder interessant.“
Inwiefern kann die Gedenkstättenarbeit mit Kindern einen Beitrag gegen Rechtsradikalismus, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus für eine demokratische Gesellschaft leisten?
„Ich denke nicht, dass NS-Gedenkstätten ‚Bollwerke‘ gegen Rechts sind und sein können. Doch als außerschulische Lernorte, die sich aufgrund der historischen Ereignisse mit Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Faschismus beschäftigen, ist es leichter möglich, aktuelle Beispiele aufzuzeigen, um daran die Aktualität von Geschichte zu verdeutlichen. Wir machen an den Gedenkstätten historisch-politische Bildungsarbeit, die zum Nachdenken hoffentlich einlädt. Aber Gedenkstätten sind keine ‚Erziehungsheime‘. Und bereits mit rechtem Gedankengut ‚infizierte‘ Kinder und Jugendliche bedürfen erzieherischer Maßnahmen und Begegnungen mit Menschen, die zu ihrem Vorurteilsbild gehören. Das leisten Gedenkstätten nicht.“
Welches Wissen würden Sie gerne mit Menschen teilen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind?
„Das Wissen um die enorme Empathiefähigkeit von Kindern, die nichts mit Überwältigung zu tun hat (s. Beutelsbacher Konsens). Die ungeheure Fantasie, mit der sich Kinder den historischen Ereignissen nähern und sie ins hier und jetzt übertragen können. Das wird dort deutlich, wo Kinder Spielszenen anhand von Biografien von Opfern und Täter*innen entwickeln. Und das Wissen über das Wissen der Kinder. Es ist immer wieder erstaunlich, wieviel Wissen/Informationen zum Thema NS bei den Kindern schon vorhanden ist, wenn auch nicht sortiert und schon gar nicht reflektiert.“
Welchen Stellenwert müssen Gedenkstätten Ihrer Meinung nach in einer zukünftigen Erinnerungskultur haben?
„Mir scheint es notwendig zu sein, dass Erinnern und Gedenken nicht nur an festgelegten Gedenktagen stattfindet. Das hat oftmals etwas in Ritualen Erstarrtes, Formalisiertes, Steifes, wenig Lebendiges. Die aber, die sich erinnern (sollen), sind lebendige Menschen, denen Gestaltungsmöglichkeiten des Erinnerns und Gedenkens gegeben werden müssen. Und das ist der Beitrag den Gedenkstätten leisten. Und zwar ganzjährig mit den ihnen eigenen Themenschwerpunkten. Ohne NS-Gedenkstätten bleibt es bei Feiertagsreden und kommt nicht bei Kindern und Jugendlichen an.“